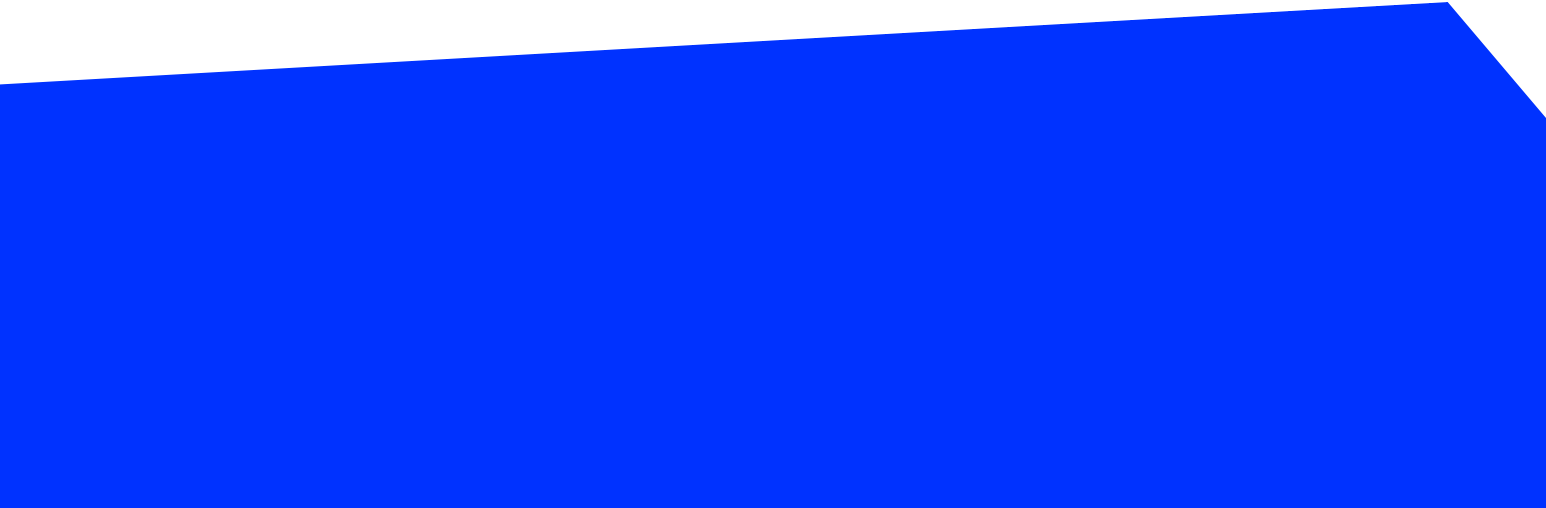Together Against Online Hate: Die Bedeutung von intersektoraler Zusammenarbeit in der Durchsetzung des DSA
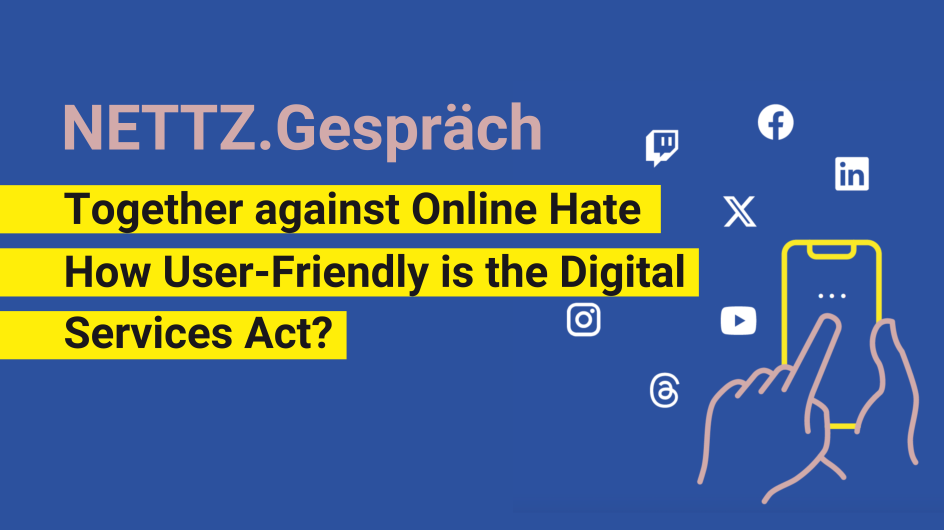
Wie wirksam sind die Meldewege nach dem DSA wirklich? Dieser Frage sind wir in unserer am 10. Oktober 2025 veröffentlichten Studie „Zwischen Klick und Konsequenz: Eine Evaluation der Meldeverfahren nach dem Digital Services Act“ nachgegangen. Die Ergebnisse unserer Studie zeigen: Die meisten Nutzer*innen möchten problematische Inhalte zwar melden, fühlen sich aber von rechtlichen Begriffen, unübersichtlichen Auswahlmöglichkeiten oder mangelndem Feedback beim Meldeverfahren abgeschreckt. Jede vierte Meldung über den DSA-Weg wird deshalb abgebrochen.
In unserem NETTZ.Gespräch am 27.Oktoberhaben wir gemeinsam mit Martina Maiello, Sachbearbeiterin für den Digital Services Act beim Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (DG CNECT, Europäische Kommission), Michael Terhörst Leiter der Stelle zur Durchsetzung von Kinderrechten in digitalen Diensten (KidD, Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz) sowie den Co-Autorinnen der Studie Lena-Maria Böswald, Ursula Schmidt und Corinna Dolezalek die Ergebnisse unserer Studie diskutiert.
Einblicke aus der EU-Kommission
Martina Maiello hat uns zunächst einen Ausblick auf laufende und bevorstehende Maßnahmen der Europäischen Kommission im Rahmen des DSA gegeben. So sollen demnächst die zweiten „Risk Assessment Reports“ durch große und sehr große Online-Plattformen veröffentlicht werden. In diesen Berichten müssen die Plattformbetreiber systemische Risiken wie die Verbreitung illegaler Inhalte, Desinformation und Auswirkungen auf Grundrechte und öffentliche Sicherheit in ihren Diensten identifizieren. Außerdem soll dargelegt werden, wie diesen Risiken entgegengewirkt werden kann und welche Maßnahmen die Plattformen dazu unternehmen. Die ersten „Risk Assessment Reports“ wurden Ende 2024 veröffentlicht.
Außerdem wurden laut Maiello erst letzte Woche Verfahren gegen große Online-Plattformen durch die EU-Kommission eingeleitet: So wurden Facebook & Instagram (Meta) gerügt, weil ihre Meldewege nicht leicht auffindbar und nicht nutzer*innenfreundlich seien. Zudem würden beide Plattformen sogenannte „Dark Patterns", manipulative Design-Tricks auf Websites und Apps, in der Gestaltung der Meldewege nutzen.
Die Bedeutung von Zusammenarbeit
Michael Terhörst hebt in seinem Beitrag die Bedeutung der Studie „Zwischen Klick und Konsequenz“ hervor, deren Ergebnisse für Behörden wie KidD eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des DSA spielen. Er unterstreicht die Forderung nach transparenten und leicht zugänglichen Meldewegen sowie den besonderen Schutzbedürfnissen von Kindern und Jugendlichen auf Online-Plattformen. Terhörst plädiert für eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Plattformbetreiberinnen und verweist unter anderem auf die wichtige Arbeit der europäischen Arbeitsgruppe zum Jugendschutz sowie des deutschen Partnernetzwerks der KidD, zu dem auch Das NETTZ gehört.
Trotz regelmäßigen Austauschs mit den meisten Plattformen berichtet er auch von Herausforderungen: Viele Betreiber*innen setzen ihre eigenen Community-Richtlinien und die Anforderungen des DSA nur unzureichend durch, wodurch eine deutliche Diskrepanz zwischen den formulierten Ansprüchen und der tatsächlichen Umsetzung sichtbar wird.
Was nehmen wir mit?
Seit Februar 2024 ist der Digital Services Act (DSA) fest in der EU-Gesetzgebung verankert. Er verpflichtet große Online-Plattformen, nutzer*innenfreundliche Meldewege für rechtswidrige Inhalte bereitzustellen. Unsere Studie – und die Beiträge unserer Gäst*innen – zeigen jedoch deutliche Umsetzungsprobleme: Durch „Dark Patterns“ und unübersichtliche Meldeprozesse werden die DSA-Meldewege oft als wenig zugänglich wahrgenommen. Stattdessen nutzen viele die internen Community-Meldungen – selbst bei strafrechtlich relevanten Inhalten. Dadurch greifen die DSA-Schutzmechanismen nicht, Betroffene erhalten weniger Unterstützung und die Rechtsdurchsetzung wird erschwert.
Ein weiteres Hindernis ist der Mangel an rechtlicher Orientierung: Viele Nutzer*innen wissen nicht genau, welche Inhalte strafbar sind, und brechen Meldungen aus Angst vor Fehlern oder rechtlichen Folgen ab. Hier braucht es mehr öffentliche Aufklärung und transparente Meldeprozesse – etwa durch leicht verständliche Guides: Was passiert nach einer Meldung? Welche Folgen hat sie für die Nutzer*innen? Ab wann gilt ein Inhalt als strafbar?
Unser NETTZ.Gespräch macht deutlich: Es braucht eine enge Zusammenarbeit zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Plattformen. Studien wie „Zwischen Klick und Konsequenz“ liefern dafür wichtige Daten und Argumente, um Plattformbetreiber*innen stärker in die Verantwortung zu nehmen. Zivilgesellschaftliche Akteurinnen leisten bereits wertvolle Aufklärungsarbeit – doch auch Plattformen müssen ihren Teil beitragen und klare, nachvollziehbare und transparente Meldewege schaffen.
Falls euch Veranstaltungen wie dieses NETTZ.Gespräch interessieren, abonniert gerne unseren Newsletter. Dort informieren wir regelmäßig über Neuigkeiten, Projekte und Events rund um das Thema Hass im Netz.
Förderhinweis
Das NETTZ.Gespräch ist eine Veranstaltung von Das NETTZ als Teil von toneshift – Netzwerk gegen Hass im Netz und Desinformation und wird gefördert vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ vom Bundesministerium für Bildung, Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Für inhaltliche Aussagen und Meinungsäußerungen tragen die Publizierenden dieser Veröffentlichung die Verantwortung.

Joy Hwang
(sie/ihr) Werkstudentin